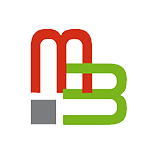Kooperation PH Heidelberg
Klimawandel findet Stadt
Das geplante Projekt zielt auf die Förderung der Bewertung von Klimafolgen und Anpassungsstrategien in städtischen Räumen durch Schülerinnen und Schüler ab. Während der Aspekt Klimaschutz bereits in etlichen Bildungskonzepten und -materialien aufgegriffen wird, findet das Thema Anpassungsstrategien derzeit kaum Berücksichtigung in konkreten Lehr-Lern-Konzepten in entsprechend praxisorientierten Materialien. Das zentrale Ziel des avisierten Projekts ist es daher, sich dieses Desiderates anzunehmen. Im Sinne des entdeckenden und forschenden Lernens orientiert sich das modularisierte Konzept an der Verknüpfung von Beobachtungs-/Erfahrungsraum (Lebensumfeld Stadt), Experimentierraum (schulischer und außerschulischer Lehr-Lern-Ort) und Handlungsraum (Raum zur gesellschaftlichen und individuellen Umsetzung von Anpassungsmaßnahmen).
Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, im Rahmen eines Besuchs des Schülerlabors an ausgewählten Module (je nach thematischer Ausrichtung des Unterrichts) aktiv teilzunehmen.
Beteiligte Lehr-/Lernlabore
Durch eine Allianz von drei geoökologisch ausgerichteten außerschulischen Lehr-Lern-Laboren in Bochum, Heidelberg und Trier sollen die entsprechenden Konzepte und Lernmodule mit unterschiedlicher regionaler, inhaltlicher und methodisch-didaktischer Schwerpunktsetzung gemeinsam entwickelt werden.
Struktureller Aufbau und geplante Handlungsfelder des Projekts „Klimawandel findet Stadt“
Kern des zu entwickelnden Bildungskonzeptes, das sich der in Abbildung 1 beispielhaft genannten Themen annimmt, wird die didaktische Verschränkung von Beobachtungs-/Erfahrungsraum, Experimentierraum und Handlungsraum sein.
Mit Beobachtungs‐/Erfahrungsraum ist der urbane Raum gemeint, der maßgeblich die Alltags- bzw. Lebenswelt der Jugendlichen darstellt. In diesem Raum findet Klimawandel konkret statt, seine Folgen und Auswirkungen können untersucht werden, woraus sich – auch im Sinn eines Reallabors – in und aus der Praxis konkrete Forschungsfragen generieren lassen. Unter urbanen Räumen werden dabei alle städtisch geprägten Räume unterschiedlicher Größenordnung verstanden, in denen entsprechende charakteristische Effekte beobachtbar sind – also nicht nur größere Agglomerationsräume, sondern auch Klein- und Mittelstädte.
Die Fragestellungen können dann mit verschiedenen Methoden der Erkenntnisgewinnung (u. a. Untersuchungen, Versuche, Experimente, Modellierungen) bearbeitet werden. Dies kann insbesondere durch „Vor-Ort-Experimente“ direkt im städtischen Raum, im schulischen Kontext und/oder im Rahmen von Modellexperimenten im Lehr-Lern-Labor erfolgen, die in diesem Sinne als Experimentierraum fungieren.
Die resultierenden Forschungsergebnisse liefern Antworten auf die entwickelten Fragestellungen und bieten die Grundlage für Lösungsansätze im urbanen Handlungsraum, also dem Raum, in dem sich konkrete Anpassungsstrategien umsetzten lassen und damit klimaadäquates Handeln realisiert werden kann. Insofern ist der Beobachtungs-/Erfahrungsraum zugleich Lern- und auch Handlungsraum.
Der Beobachtungs-/Erfahrungsraum bildet zusammen mit dem Handlungsraum für die Jugendlichen gleichsam den „Realraum“ ihrer eigenen Alltags- und Lebensumwelt. Verknüpft mit dem forschend entdeckenden Experimentierraum ergibt sich so für die Jugendlichen ein Reallabor, in dem sie an praxisgeleiteten Fragestellungen Akteure werden.
Schwerpunktbereichen der Hochschulstandorte Bochum, Heidelberg und Trier
Die Hochschulstandorte befassen sich mit einem Bereich Gesundheit/Risikoprävention, Stadtökologie/Biodiversität oder Stadtklima/Stadtplanung. Aus jedem Bereich resultieren verschiedene Module, die an dem jeweiligen Standort in Kooperation mit Schulen entwickelt und erprobt und dann an allen Standorten umgesetzt werden. Tabelle 1 gibt einen Überblick über mögliche Module.
Zielgruppen und Kooperationspartner
An dem Projekt sollen in jeder Partnerstadt ausgewählte Real-, Gesamtschulen und Gymnasien teilnehmen. Zielgruppen sind die Schüler der Klassen 8 bis 12. Die Jugendlichen sollen im Sinne des moderaten Konstruktivismus angeleitet werden, aber dennoch möglichst aktiv und selbständig in Tandems oder Kleingruppen ihre Untersuchungen und Analysen im Real-, Experimentier- und Handlungsraum durchführen. Um die Lernmodule darüber hinaus in unterschiedlichen Altersklassen (von 14 bis ca. 17 Jahren) bzw. Schulstufen (Sek. I und Sek. II) einsetzten zu können, werden sie im Sinne der Lernprogression in Form eines Baukastensystems aufgebaut. Ausgehend von einem basalen Ausgangsbaustein kann jedes Modul durch weitere vertiefende und differenzierende, immer höhere Anspruchsniveaus erreichende Bausteine erweitert werden. Ergänzt werden die Module durch Angebote für die (lehrplanbezogen) Einbindung in den Fachunterricht.
Die Module werden unter Mitwirkung der Fachkolleginnen und -kollegen vor Ort entwickelt, indem ihnen die Konzepte vor der Umsetzung zur Diskussion vorgelegt und sie in den Prozess der Reflektion sowie Weiterentwicklung eingebunden werden.